Kollaboration und Kontext
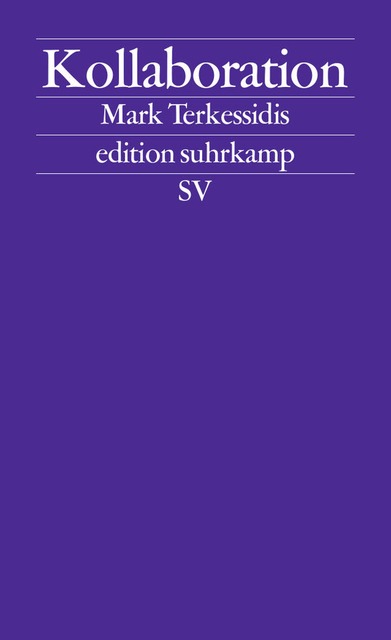
Wenn sich die Hierarchien zwischen Autor und Leser, Verlag und Leser einebnen oder gar aufheben, definiert sich das, was man als den Funktionszusammenhang von Literatur verstehen kann, gänzlich anders als bisher. Kollaborative und synergetische Faktoren beeinflussen Produktion und Rezeption. Was Texttheorien schon seit etlichen Jahrzehnten als Intertextualität formulieren, als das Zusammenspiel von Ko- und Kontexten, was eine auf die literarische Ästhetik übertragene Frametheorie beschreiben müsste: das hebt die Literatur als Ganzes aus den Angeln. Genauer: das, was gemeint war, wenn von der Literatur gesprochen wurde. Gemeint war damit eigentlich immer eine Sinnkonstruktion, ein Versprechen, dass sich zu einem Ganzen fügt, was längst schon anderen ästhetischen Zielen folgt und was längst unter Bedingungen rezipiert wird, die mehr über die prinzipielle Instabilität des Sinnversprechens berichten als dessen eventuelle Haltbarkeit zu garantieren.
Jetzt und in Zukunft geht es um literarische Kontexte, um Literatur als Kontext. Dieser Kontext ist kein Container, der die Literatur beinhaltet. Kontext kann die Technologie sein, mit der literarische Kontexte hergestellt oder rezipiert werden. Kontext ist, was sich konstituiert, wenn die Grenzen zwischen Produktion und Rezeption nicht mehr eindeutig zu bestimmen sind oder ihre Bestimmung nicht länger sinnvoll erscheint. Kontext sind die formalen (also textuellen und sprachlichen) Strukturen, aber auch die finanziellen Strukturen, die erlauben, dass man in diesem Kontext kauft und verkauft. Kontext ist also auch ein anderes Wort für Medium – und umgekehrt.
Literatur als Kontext ist das, was übrig bleibt. Gefragt wird nicht mehr, was sie alles ist, was sie alles können und ausdrücken, darstellen und bedeuten soll. Es wird nur konstatiert, was sie nicht ist. Um zu definieren, was mit dem Begriff Literatur oder eben mit dem Kontext Literatur verbunden werden kann, muss nach und nach alles weggelassen werden, was nicht unbedingt notwendig ist. Wie bei einem Tisch, der erst dann umfällt, wenn man eines von vier Beinen entfernt. Aber wer weiß, vielleicht kontextualisiert sich gerade erst in dieser Beschädigung eines konventionalisierten Funktionszusammenhangs, was Literatur vermag: einen neuen Kontext herzustellen durch Überschreitung. Das ist auch weniger eine minimalistische Sicht literarischer Möglichkeiten als eine Art Funktionscheck: für das, was weggelassen wird, gibt es ja möglicherweise Ersatz oder vielmehr noch eine bessere Lösung. Es geht also um eine Perspektive auf Literatur als Praxis: diese Literatur ist nichts, was fertig wäre, sondern immer nur vorläufig ist, instabil, prozessual, reduzierbar ebenso wie zu vervollständigen, immer in Bewegung.
Das heißt auch, dass eine solche Beschreibung nicht einem funktionalistischen Universalismus das Wort redet. Denn literarische Praxis ist immer konkret und spezifisch. Ihr Kontext definiert sich zeitlich wie räumlich. Das ist mit Vorläufigkeit gemeint: eine zeitliche und eine räumliche Präposition, die sich gegenseitig relativieren.
Literatur findet in anderen Formen, an anderen Orten statt als allein in dem Koordinatensystem Autor-Leser-Buch-Verlag-Buchhandel. Literatur ist ein Medium und wird als Medium produziert und rezipiert. Die Allgegenwärtigkeit der Medien ist keine neue und wenn neue, eben nicht allein neue Erscheinung. Ihre Konkretionen werden mittlerweile nur anders wahrgenommen: in Form von Dingen. Mangels diskursiver Objektivationen rücken dingliche Aspekte des literarischen Kontextes in den Blick. Qualitativ unterscheidet sich etwa die Diskussion über die Andere Bibliothek, wie sie Hans Magnus Enzensberger und Franz Greno in den 1980er Jahren angestoßen haben, indem sie traditionelles Handwerk der Buchherstellung gegen den massenhaften Einsatz von Offset-Technik im Buchdruck positionierten, nicht von Debatten über Vor- und Nachteile digitaler Lesegeräte oder über den Vormarsch des Non-Book-Segmentes im Warenangebot des Buchhandels. Diese Debatten sind in ihrem Verlauf meist leicht vorhersagbar, denn sie verschleiern in der Regel, dass es immer spezifische Gründe gibt, eine bestimmte Technologie zu nutzen, eine bestimme Praxis zu verändern. Sie verschleiern auch den Blick auf Paradoxa, die ebenso immer konstitutiv für (neue) literarische Kontexte sind. Je leichter der Zugang zu einer neuen Technologie und der damit verbundenen Rezeptions- und Produktionspraxis, desto erfolgreicher ist die Technologie bei jedem Einzelnen. Dass Lesen dann etwa immer noch als grundsätzlich einsame Tätigkeit definiert wird, gehört zu einer auf kurzschlüssige Aufmerksamkeit bedachten Publizität und nimmt nicht wahr, dass sich Lesen gleichzeitig als eine soziale Praxis realisiert. Die Wiedersprüchlichkeit der Symptomatik geht noch weiter, muss es sich doch beim Objekt sozialen Lesens und einsamen Lesens nicht um denselben Text handeln. Es müssen nicht einmal Schnittmengen existieren. Die Erwartung, beides in Einklang bringen zu können, verdankt sich lediglich einer der Sinnproduktion, der Autorität eines möglichst unspezifischen Sinnversprechens verpflichteten Kultur.
Um das Potential der Instabilität literarischer Kontexte in Bezug auf das Lesen, auf das soziale Lesen im Besonderen, beschreiben zu können, ist ein Blick auf die Bedingungen ihrer sozialen Praxis lohnend. Soziale Praxis ist immer reziprok. Jede Gabe ist verpflichtend. Denn ihr folgt eine Gegengabe und sie ist immer schon selbst eine Gegengabe.
Mark Terkessidis: Kollaboration. Suhrkamp 2015, 332 Seiten.